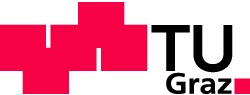Sprachwandel – Verbesserung oder Verfall?#
von Martin HaspelmathAlle Sprachen verändern sich ständig, wenn auch so langsam, dass die Veränderungen nicht leicht wahrzunehmen sind. Aber wenn man etwa das heutige Deutsch mit Luthers Sprache vergleicht, oder das heutige Englisch mit Shakespeares Sprache, springen die Unterschiede sofort ins Auge. Die folgende berühmte Passage von Martin Luther kann als Illustration dienen:
"Man mus nicht die buchstaben inn der lateinischen sprachen fragen, wie man sol Deutsch reden, wie diese esel thun, sondern man muss die mutter jm hause, die kinder auff der gassen, den gemeinen man auff dem marckt drumb fragen vnd den selbigen auff das maul sehen, wie sie reden, und darnach dolmetzschen, so verstehen sie es den vnd mercken, das man Deutsch mit jn redet."
Die Sprachwissenschaft teilt die Sprachgeschichte ein in Perioden wie "Althochdeutsch", "Mittelhochdeutsch", "Neuhochdeutsch", oder "Latein", "Altfranzösisch", "Neufranzösisch", aber in Wirklichkeit haben wir es natürlich mit graduellen Übergängen zu tun. Jede Generation spricht ein wenig anders als die vorhergehende, aber die Verständigung zwischen Großeltern und Enkeln ist niemals gefährdet. Der Sprachwandel geht so allmählich vor sich, dass er den Sprachbenutzern zum größten Teil verborgen bleibt.
Immer wieder aber artikulieren Gebildete, für die die korrekte Beherrschung der Standardsprache einen hohen ideellen Wert darstellt, ihre Unzufriedenheit mit bestimmten Neuerungen, vor allem im Bereich des Wortschatzes. Im deutschen Sprachraum betrifft das heutzutage in erster Linie die Verwendung von Fremdwörtern aus dem Englischen, oder auch von nach fremdem Muster gebildeten Ausdrücken wie Sinn machen. Die Unzufriedenheit mit Neuerungen ist aber viel älter. Ein populäres Nachschlagebuch von 1906 z.B. kritisiert Ausdrücke wie Ergebnisse erzielen, eine Entscheidung begrüßen, ein Gedicht vertonen als "sinnlos und geschmacklos", als "ganz abgeschmackte Neuerung", und als "abscheuliche Verdeutschung". Diese Ausdrücke erscheinen uns heute, nach hundertjähriger Gewöhnung, als völlig normal und zeigen damit, dass die Kritik nicht in irgendwelchen konkreten Eigenschaften der Neuerungen, sondern einzig in ihrer Ungewohntheit begründet ist.
Aber Klagen der älteren Generation über den Sittenverfall der Jüngeren sind in vielen Kulturen und zu allen Zeiten anzutreffen gewesen, und die Vorstellung, dass auch die Sprache verfällt, wenn man nicht gut auf "Sprachpflege" oder "Sprachkultur" achtet, passt gut in dieses Schema. Vielfach ist das Insistieren auf bestimmten Sprachnormen aber auch als Verteidigung von gesellschaftlichen Positionen zu sehen. Denn in jeder Sprache gibt es viele schichtspezifische Besonderheiten, und gerade die gebildete Schicht tendiert dazu, ihre eigenen sprachlichen Eigenheiten als überlegen und als maßgeblich für die ganze Gesellschaft zu betrachten. So wird etwa die Pluralform Atlasse (zu Atlas) als falsch bezeichnet: es müsse Atlanten heißen, weil das aus dem Griechischen stammende Wort auch in der Ursprungssprache einen solchen Stammwechsel zeigt.
Bisweilen wird auch versucht, die Ablehnung einer sprachlichen Besonderheit inhaltlich zu begründen. So hört man oft, die Form der einzigste (statt standardsprachlich der einzige) sei unlogisch, weil man einzig dem Sinn nach nicht steigern könne. Der Irrtum hier ist, zu glauben, dass es sich bei der einzigste um eine Steigerungsform handele: Die Form der einzigste hat natürlich genau dieselbe Bedeutung wie der einzige und ist nicht etwa Teil eines Steigerungsparadigmas einzig, einziger, am einzigsten. Dass sie auch die Stammerweiterung -ste hat (wie etwa der er-ste, der zwanzig-ste, der schön-ste), macht durchaus Sinn, denn alle diese Wörter auf -ste haben eine gemeinsame Bedeutungskomponente.
Die Vorstellung vom Sprachverfall als einem generellen historischen Trend war im 19. Jahrhundert in der Folge der Romantik weit verbreitet. Den Sprachwissenschaftlern war vor allem aufgefallen, dass in einer Reihe von europäischen Sprachen (germanischen, romanischen und slawischen) der Reichtum der morphologischen Formen (Konjugation und Deklination) im Laufe der Jahrhunderte kontinuierlich abgenommen hatte. Im Vergleich zum Latein oder gar zum klassischen Griechisch schienen die modernen Sprachen grammatisch verarmt zu sein. Übersehen wurde dabei allerdings, dass gleichzeitig auch neue grammatische Konstruktionen aufgebaut wurden (z.B. der bestimmte und unbestimmte Artikel, das werden-Futur, das haben-Perfekt, die Differenzierung von werden-Passiv und sein-Passiv, usw.).
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, im Zuge des allgemeinen Fortschrittsoptimismus, kam dann auch die Idee auf, dass der generelle historische Trend in Richtung Sprachverbesserung gehe: der Verlust der alten morphologischen Formen sei eine Befreiung von unnötigem Ballast, die Ersetzung durch umschreibende Konstruktionen sei effizienter und moderner. Aber auch hier wurde übersehen, dass im Laufe des Sprachwandels nicht nur Unregelmäßigkeiten abgebaut, sondern auch neu aufgebaut werden.
Im 20. Jahrhundert setzte sich dann auch in der Linguistik die uniformitaristische Sicht durch, wie zuvor in den Naturwissenschaften: in der Sprache gelten heutzutage keine anderen Prinzipien als früher, d.h. die Sprachen waren früher weder besser noch schlechter, weder primitiver noch komplexer, weder plumper noch eleganter als heute. Bestätigt wurde diese Auffassung durch die immer bessere Kenntnis von Sprachen aus allen Erdteilen, auch von Sammler- und Jägervölkern mit wenig ausgeprägter materieller Kultur. Keine dieser Sprachen ist in irgendeinem Sinne primitiver oder einfacher als die Sprachen von Völkern mit hoch entwickelter Technologie. Natürlich fehlt in diesen Sprachen der Fachwortschatz für Dinge, mit denen die Spracher nicht vertraut sind, aber ebenso fehlt den Sprechern unserer Kultur (außer professionellen Experten) der Wortschatz für die meisten uns umgebenden Tier- und Pflanzenarten, was aus der Sicht der Jäger- und Sammlervölker als Anzeichen für Sprachverarmung fehlinterpretiert werden könnte.
Es gibt also aus sprachwissenschaftlicher Sicht keinen Grund zu der Annahme, dass Sprachen im Laufe der Zeit "besser" werden oder "verfallen" könnten. Solange eine Sprache von Sprechern benutzt wird, wird sie ihren Aufgaben gerecht werden, und wenn neue Aufgaben hinzukommen (etwa durch gesellschaftliche oder technologische Veränderungen), ist jede Sprache flexibel genug, um sich anzupassen, z.B. durch Neubildung von Wörtern (wie Festplatte, Betriebssystem) oder durch Entlehnung (wie Computer, Chip). Im wörtlichen Sinne "verfallen" kann eine Sprache allerdings dann, wenn sie von den Sprechern zugunsten einer anderen Sprache aufgegeben wird. So wird etwa das Bretonische in Nordwest-Frankreich von immer weniger Menschen gesprochen, und viele Bretonen der jüngeren Generation beherrschen es deshalb nur noch in einer rudimentären ("verfallenen") Form oder können nur noch Französisch. Aufgrund der großen gesellschaftlichen Veränderungen überall auf der Welt werden in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich mindestens die Hälfte der jetzt noch gesprochenen ca. 6000 Sprachen aussterben. Das ist ein dramatischer "Sprachverfall", aber er beruht nicht auf Sprachwandel, sondern auf Sprachwechsel, d.h. der Entscheidung der Spracher, eine andere Sprache zu verwenden.
Eine andere durchaus reale Art von "Sprachverfall" ist das Verschwinden einer Standardsprache. So gab es etwa im Mittelalter in Süd-Frankreich eine wichtige Literatursprache, das Provenzalische, die auch außerhalb Frankreichs durch die Dichtungen der Troubadouren Berühmtheit erlangte. Später wurde dann auch im Süden des Landes die nordfranzösische (Pariser) Standardsprache verwendet, d.h. das Provenzalische wurde nicht mehr in der Schule unterrichtet und überhaupt nicht mehr als Schriftsprache gebraucht. Die provenzalische Literatursprache ist also "verfallen", aber als gesprochene Umgangssprache lebt sie bis heute fort (jetzt Okzitanisch genannt). Weil es keine schriftliche Standardform mehr gibt, die allen Sprechern als Vorbild dienen könnte, ist das Okzitanische in viele örtliche Dialekte "zerfallen". Ähnlich ist die Geschichte des Niederdeutschen, das vor einem halben Jahrtausend als überregionale (und sogar internationale) Handelssprache im Hanseraum verwendet wurde, jetzt aber nicht mehr als Schriftsprache gebraucht wird und auch keine Standardform mehr hat.
Neben den Veränderungen der sozialen Rolle einer Sprache gilt das Augenmerk der Sprachwissenschaft vor allem auch den strukturellen Auswirkungen des Sprachwandels im Bereich der Grammatik. Alle Bereiche des Sprachsystems sind ständigen langsamen Veränderungen unterworfen: der Wortschatz, das Lautsystem, die Morphologie und der Satzbau. Obwohl Sprachwandel viel zu komplex ist, um Prognosen möglich zu machen, gibt es doch bestimmte Gesetzmäßigkeiten des Sprachwandels. Schon vor zwei Jahrhunderten erkannte man, dass morphologische Bildungselemente typischerweise aus selbständigen Wörtern entstehen. Zum Beispiel kommt die Endung -lich (wie in freundlich, häuslich) von einem alten Wort liich, das "Körper, Gestalt" bedeutete (vgl. noch das jetzige Wort Leiche), und die Vergangenheitsendung -te (wie in kauf-te) ist eine reduzierte Form von tat. Der umgekehrte Wandel, also die Entstehung von selbständigen Wörtern aus morphologischen Bildungselementen, kommt praktisch nie vor. Beim Lautwandel hängen viele Veränderungen offenbar mit dem Wunsch nach vereinfachter Aussprache zusammen. Unbetonte Vokale werden verkürzt oder ganz weggelassen (z.B. althochdeutsch samanoon, mittelhochdeutsch samenen, samelen, jetzt sammeln), Konsonantenverbindungen werden vereinfacht (z.B. mittelhochdeutsch werelt, werlt, jetzt Welt), und Konsonanten gleichen sich benachbarten Lauten an (z.B. wurde ent-fangen zu emp-fangen). In der Morphologie werden Stammwechsel typischerweise ausgeglichen: statt ward/wurden heißt es jetzt wurde/wurden, statt sang/sungen jetzt sang/sangen.
Insofern lautliche Reduktionen und morphologische Regularisierungen "Verbesserungen" sind, kann man sagen, dass diese strukturellen Veränderungen das Sprachsystem verbessern. Ganz wichtig dabei ist aber, dass die Verbesserungen strikt lokal sind, d.h. auf einen begrenzen Bereich des Systems beschränkt. Global wird das system nicht besser, zumal lokale Verbesserungen oft lokale Verschlechterungen in benachbarten Bereichen auslösen. So führt etwa die Vokalreduktion von samelen zu sammeln (eine lokale lautliche Verbesserung) dazu, dass die Infinitivendung jetzt unregelmäßiger geworden ist: manchmal -en (wie bei sing-en), manchmal -n (wie bei sammel-n) (also haben wir hier eine eine lokale morphologische Verschlechterung)
Sprachwandel ist also weder Sprachverfall noch Sprachverbesserung: Solange Sprachen gesprochen werden, sind sie für ihre Aufgaben angemessen. Strukturelle Veränderungen können oft lokal als Verbesserungen betrachtet werden, aber global wird das grammatische System weder besser noch schlechter.